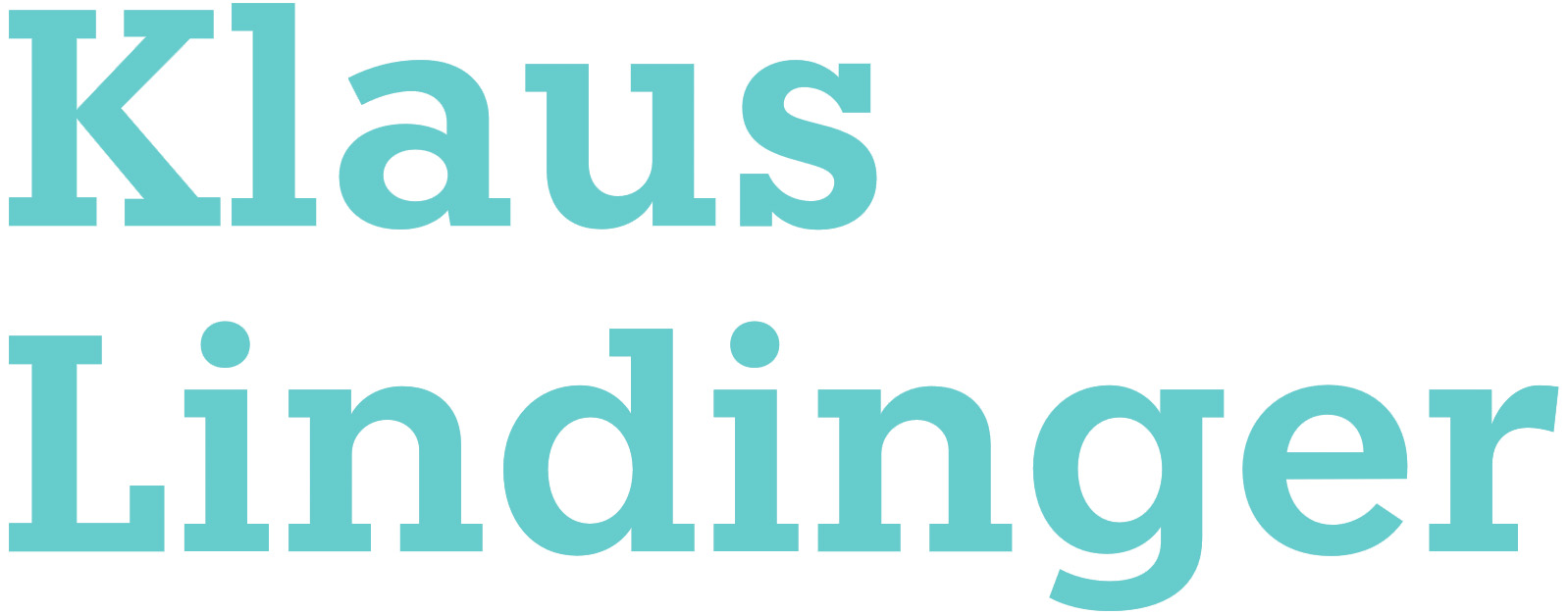Der Bauernbund ist die einzige bäuerliche Interessensvertretung, die in den Entscheidungsgremien aller politischen Ebenen – egal ob Land, Bund oder Europäische Union – vertreten ist. Ohne Einbindung des Bauernbundes in die Regierungs- und Parlamentsarbeit – aber auch auf Gemeinde-, Landes- und Bezirksebene – wird die Landwirtschaft von nicht praktikablen Vorschriften überrollt und es droht eine Belastungslawine für unsere bäuerlichen Familienbetriebe. Der Bauernbund ist ein verlässlicher Partner für die heimische Landwirtschaft und die Besitzer von Grund und Boden.
Bei der Wahl am 24. Jännner wird nicht nur die Zusammensetzung in der Kammer gewählt. Es werden auch die bäuerlichen Vertreterinnen und Vertreter auf Ortsebene entschieden.
Unsere Bezirkskandidaten:
Franz Waldenberger aus Pennewang: Ochsenmast, Biobetrieb mit Direktvermarktung von Erdäpfel, Eiern, Dinkelprodukte und Rindfleisch im „Bio-Drive-In“, Obmann Bio Austria OÖ, Bürgermeister.
Teresa Lachmair aus Steinhaus: Schweinezucht, Ackerbau, Forst und Hobbyimkerei, Direktvermarktung von „Hegartners Bienenhonig“ und dessen Nebenbprodukten wie Wachstücher, junge Mutter und sehr engagiert im Ort und in der Bezirkspartei.
Pauline Mittermayr aus Pennewang: Legehennenhaltung, Ackerbau, Direktvermarktung, Seminarbäuerin, junge Mutter und früher sehr engagiert in der Landjugend.
Markus Brandmayr aus Eberstallzell: Schweinehaltung mit Ferkel-produktion, Ackerbau, Ortsbauernobmann und im Ort sehr engagiert.

Leopold Keferböck: Unsere Bauern sind Rückgrat der Versorgung in der Region
Unsere Bäuerinnen und Bauern mit ihrer aktiven Bewirtschaftung von Grund und Boden, mit flächengebundener Veredlungsproduktion und mit ihrer in Generationen denkenden Wirtschaftsweise sichern die Lebensmittelversorgung. Um diese auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können, braucht es stabile und vor allem praktikable Produktionsbedingungen. Es braucht zudem einen Schulterschluss zwischen Produzenten, Handel und Konsumenten bei Akzeptanz und Preisgestaltung, um allen (auch dem Landwirt) ein wirtschaftliches Überleben zu ermöglichen. ‚Lockangebote‘ sind nur scheinbar billig. Langfristig zahlen alle drauf, weil dann der Bedarf mit importieren Fleisch gedeckt werden müsste, wo wir keine Gütesiegel und Kontrollmöglichkeiten haben.

Margit Ziegelbäck: Lebensmittelkompetenz bei Kindern stärken
Der direkte Bezug zwischen Produzenten und Konsumenten ist vielfach verloren gegangen. Qualifizierte oberösterreichische Landwirte ermöglichen seit zwei Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen im Rahmen von „Schule am Bauernhof“ die Landwirtschaft wieder hautnah zu erleben. Gerade die Zeiten des Lockdowns haben vielen Menschen verdeutlicht, dass wertvolle Kenntnisse und Kompetenzen der Lebensmittelauswahl, Lagerung und Zubereitung mittlerweile „auf der Strecke“ geblieben sind. Ein großes Ziel der Bäuerinnen ist es, dass in Österreich alle SchülerInnen wissen, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie verarbeitet werden können und dass der regionale Einkauf nicht nur unser Klima schützt, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung im eigenen Land sichert. Dazu ist es notwendig, die Ernährungs- und Konsumbildung in allen Schulen im Lehrplan zu verankern.

Franz Waldenberger: Regionale Bio-Lebensmittel liegen voll im Trend
Der Absatz von Bio-Lebensmitteln im Handel hat erstmals den Umsatzanteil von 10% überschritten. Österreich ist mit einem Bioanteil von 25% an der landwirtschaftlichen Fläche Bio-Vorreiter in Europa. Damit diese Vorreiterrolle weiter ausgebaut werden kann, braucht es einerseits einen steigenden Absatz für heimische Bio-Produkte und andererseits praxistaugliche Rahmenbedingungen. Ab 2022 tritt eine neue EU-Bioverordnung in Kraft. In den kommenden Monaten sind dazu viele rechtliche Details auszuformulieren. Parallel dazu wird an der Ausgestaltung des nächsten Agrarumweltprogrammes gearbeitet das ab 2023 wirksam wird. Hier geht es darum den systemischen Mehrwert der biologischen Wirtschaftsweise abzubilden und die besonderen Umweltleistungen der Biobäuerinnen und Biobauern abzugelten. Ich bin überzeugt, dass es in Österreich mit unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft noch ein großes Potential für die biologische Landwirtschaft gibt.

Teresa Lachmair: Landwirte sind Vorreiter in Sachen Digitalisierung
Begriffe wie „Smart Farming“ oder automatische Lenksysteme sind keine Zukunfts-musik sondern Tatsachen. Die Bäuerinnen und Bauern von heute nützen moderne Technologien, die die Landwirtschaft genauer, aber auch herausfordernder machen. Es ist wichtig, neben dem bodenständigen Handwerk ‚Landwirtschaft‘ für Modernes offen zu sein! Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft angekommen und wird zukünftig zu einer noch ressourcen- und somit umweltschonenderen Bewirtschaftung beitragen. Sie entlastet die Bäuerinnen und Bauern, fordert aber die ständige Weiterbildung in diesem Bereich. Immer mehr Landwirte nutzen zudem die digitalen Medien, um einen Einblick in ihre Arbeit am Feld oder im Stall zu geben und auf die Wichtigkeit unserer regionalen Lebensmittel aufmerksam zu machen.

Pauline Mittermayr: Verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist unerlässlich
Lebensmittel sind Mittel für unser Leben. Pro Person essen wir jährlich im Durchschnitt ca. 1 Tonne Lebensmittel – ein gewichtiger Grund, darüber nachzudenken, wo und warum wir bestimmte Produkte einkaufen. Der Unterschied zwischen einem österreichischen und einem ausländischen Produkt muss daher klar erkennbar sein. Im Lebensmittelhandel funktioniert die Herkunftskennzeichnung, speziell im Frischebereich bereits ganz gut. Schwierig wird es bei den verarbeiteten Produkten wie Fertigbackwaren oder tiefgekühlten Produkten. Ziemlich undurchsichtig ist leider die Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und der Gastronomie. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist unerlässlich, um die hochwertigen Produkte unserer Bäuerinnen und Bauern zu erkennen und sich bewusst dafür oder auch dagegen zu entscheiden. Die Entscheidung, ob die Wertschöpfung im eignen Land bleiben soll und ob man dem Klima und sich selbst etwas Gutes tun möchte, sollte jedoch jeder für sich selbst treffen können!

Markus Brandmayr: Versorgungssicherheit braucht konventionelle Schweinehaltung
Die angespannte Situation am Schweinemarkt ist bekannt. Durch den Wegfall an Zuliefermöglichkeiten an die heimische Gastronomie und Hotelerie ist der Absatz im Inland um 40 Prozent zurückgegangen. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland hat auch den heimischen Markt und vor allem den Schweinepreis unter Druck gebracht. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen, in dem wir verstärkt auf den Kauf von österreichischen Produkten aber auch auf die Herkunftskennzeichnung setzen. Die konventionelle Schweinehaltung sichert in Österreich zu 100 Prozent die Eigenversorgung. Besonders wichtig dabei ist, dass wir – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – mit einer starken Kreislaufwirtschaft auf bodengebundene Schweinehaltung und nachhaltige Bewirtschaftung setzen. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, junge Menschen zu motivieren trotz aller Schwierigkeiten den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Denn jedes Tief bringt wieder eine Erholung!

Klaus Lindinger: Perspektiven schaffen – Stärken zeigen!
Durch den Verhandlungserfolg von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesminister Elisabeth Köstinger zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union konnte die nachhaltige Finanzierung für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern sichergestellt werden. Ursprünglich lautete der Vorschlag der Europäischen Kommission (EK) minus 110 Millionen Euro pro Jahr. Tatsächlich ist ein Plus von
5 Millionen Euro pro Jahr für die heimische Landwirtschaft herausgekommen.

Durch zahlreiche Beschlüsse auf Bundesebene sind Perspektiven für die bäuerlichen Betriebe geschaffen worden wie zum Beispiel Agrarversicherungssystem ausgebaut, Entlastungs- und Investitionspaket, welches sowohl für Jung- wie auch Altbauern der bäuerlichen Klein- und Mittelbetriebe Zukunft eröffnet.
An vielen kleinen Rädchen wird bezüglich des Bodenverbrauchs gedreht, um die weitgehende Selbstversorgung in Österreich sicherzustellen. Aktuell werden 13 Hektar pro Tag verbaut. Diese Zahl muss dramatisch reduziert werden. Das neue Raumordnungsgesetz ist ein Puzzleteil in die richtige Richtung!
Stärke zeigt sich in der individuellen Betriebsgestaltung, die durch das profunde Beratungsangebot der Landwirtschaftskammer unterstützt wird. Die Bäuerinnen und Bauern bringen sich ehrenamtlich in den Vereinen, bei den Feuerwehren und auch in der Gemeinde ein. Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen – nicht nur in betrieblicher Hinsicht. Das breitgefächerte Kandidatenteam für die Landwirtschaftskammerwahl macht das mehr als deutlich!
Agrarstruktur im Bezirk Wels-Land:
Wels-Land hat eine Flläche von 45.770 ha, was einem Prozentsatz von 3,8 der oberösterreichischen Landesfläche ausmacht. 9,7% hingegen macht der Prozentsatz des Bezirks auf Landesebene bei der Ackerfläche aus. Das sind 28.032 ha oder 61% der Bezirksfläche. Dazu kommen 7.681 ha Waldfläche und 1.959 ha Grünfläche und 1.622 ha Biofläche sowie 217 ha mit Spezialkulturen.
53,3% der Betriebe im Bezirk sind Schweinehalter. Bemerkenswert ist, dass damit 8,9% der oberösterreichischen Schweinehalter 24,2% der oberösterreichschen Schweine halten. Das sind Stand November 2020 273.111 Schweine. Diesen Betrieben hat die afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland aber auch die Corona-Pandemie und den damit sinkenden Absatzmärkten von bis zu 40 Prozent stark zugesetzt.
455 Betriebe halten im Bezirk 250.704 Geflügel. Das macht 7,4% aller Geflügel im Land Oberösterreich aus. Wels-Land hat ca. 130 Direktvermarkter.